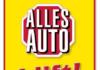Keine menschliche Schöpfung wird einem lebenden Wesen jemals so nahekommen wie das Auto.“ Wenn es ums liebe Blech ging, konnte Sir William Lyons auch schon einmal die noble Zurückhaltung vergessen. Und die Schöpfung, die er da meint, ist natürlich seine eigene: Jaguar, die Marke, die praktisch aus dem nichts kommend in kürzester Zeit zum allgemeingültigen Symbol des britischen Automobilbaus wurde. Das Zitat drängt sich aus der Erinnerung, während an einem Morgen in Südengland die Spätsommersonne durch die Blätter blinzelt und flirrende Muster auf die weite Topographie der Motorhaube des E-Type zaubert. Opalescent Silver Blue ist eine hervorragende Basisfarbe für Lichtspiele aller Art, und wer die Aussicht auf einen über zwei Meter gestreckten Vorderwagen noch nie erfahren hat, sollte dringend versuchen, das irgendwie nachzuholen – der Anblick ist schlichtweg ergreifend. Besonders, wenn er vom bulligen Klang eines Reihensechzylinders untermalt wird und es dabei ein wenig nach Lederwachs und Sprit riecht.

E-Mobilität in ihrer schönsten Form: Ein stämmiger Reihensechser unter der langen Haube, umspielt von schwungvollen Kurven und einem lichtdurchfluteten Aufbau. Der bei JLR Classic in Coventry neu geborene Jaguar E-Type rückt sämtliche Sonnenseiten des Kult-Klassikers in den Vordergrund.
Die Historie des E-Type ist rasch erzählt: Der auch im Alphabet einen Buchstaben früher angesiedelte Stichwortgeber zum Thema Sportwagen war ein alu-karossierter Renner. Der D-Type fiel vor allem wegen seiner Haifisch-Finne am kurzen Heck auf, die den langen, aber eher schmalspurigen Wagen bei hohem Tempo zu stabilisieren half. Was recht gut gelang: In den Siegerlisten namhafter Rennen wie Le Mans, Reims oder Sebring zementierte der D-Type Jaguars Ruf als Sportmarke erster Güte. Was nicht so gut gelang, war die Dinger an den Mann und, noch viel seltener, an die Frau zu bringen: Aus den geplanten 100 Stück wurden schließlich nur 75 – die letzten sogar halbherzig als XK-SS straßenzulassungstauglich umgebaut, um überhaupt Käufer zu finden. Kommt Zeit, kommt Interesse: Als Jaguar Land Rover Classic heuer verlautbarte, nun die restlichen 25 zu fertigen, waren sie in Windeseile ausverkauft – zum ergreifenden Stückpreis von 1,75 Millionen Pfund.
Der Weg zum E führte über zwei Prototypen, genannt E1A und E2A, wobei „E“ experimental und „A“ Aluminium meint. Ersterer diente zu Motor-Testzwecken, Zweiterer mutet heute äußerlich an wie das Ergebnis einer hastigen Liebe zwischen D und E – in etwa mit der Karosserieform des späteren Serienmodells plus einer wuchtigen Heckfinne ausgestattet. Im März 1961 steht der endgültige E-Type auf dem Automobilsalon in Genf: Ein Wagen mit beinahe obszöner Formgebung, aber doch haarscharf die Eleganz-Kurve nehmend. Die extrem lange Motorhaube ist ein wenig effektheischend – so viel Platz bräuchte der Reihensechszylinder eigentlich gar nicht. Den Schmäh mit der Hauben-Charade hat Lyons schon in den 30er-Jahren bei seinen Entwürfen für die Marke angewendet, die Jaguar vorausging: Standard Swallow, später auf SS gekürzt und 1945 aus naheliegenden Gründen auf die südamerikanische Großkatze umbenannt, die schon davor als Markenlogo gedient hatte.
- Es gibt großzügiger bemessenere Arbeitsplätze, auch in Sportwagen dieser Epoche. Der E-Type verlangt ein wenig Flexibilität vom Körper. Man gewährt sie ihm gerne.
- Die Schienen im Heckabteil sind hübsch und schonen die Lederhäute – allerdings zahlt es sich aus, das Gepäck fliehkraftsicher zu verzurren. Bei den Exportmodellen mit Linkslenker ist die Heckklappe auf der gegenüberliegenden Seite angeschlagen.
- Als Beckengurte und 269 PS noch keinen Widerspruch darstellten. Die Sitzchen sind übrigens nichts für breitgewachsene Hinterteile – wer sich einen E-Type anlachen will, sollte eventuell erst abnehmen.
Lyons, mit einer seltenen Naturbegabung für Design ausgestattet, hat ein feines Gespür für Form und Proportionen, ordnet sich grundsätzlich keinem Zeitgeist unter, findet aber abseits davon mehrheitstaugliche Nischen. Windkanal hat er übrigens auch keinen zur Verfügung – die Stromlinie des E-Type ist abgesehen von der kundigen Zeichner-Hand das Ergebnis aufwändiger Berechnungen. Gerade als Kanten und Ponton-Form modern werden, knallt Jaguar dieses Ding mit ausschließlich fließenden Rundungen hin, die scheinbar weder Ende noch Anfang haben, sondern unter dem Auto weiter verlaufen, quer wie längs.
In genau diesen Formen eingebettet geht es jetzt ans Erspüren der oft beschriebenen Erotik dieses Autos, die offenbar altersresistent ist. Ein Kult, der bis heute andauert. Wie viele Menschen wohl bei dem Begriff Sportwagen-Klassiker unweigerlich das Bild des E-Type im Kopf haben, wäre eine Studie wert. Das Einsteigen bedarf grundsätzlich etwas Übung und folgt gängigen Benimmregeln: Eine höfliche Verbeugung um die Türschnalle zu erreichen. Dann eine großzügige Geste, das Öffnen der Tür. Der breite Schweller verlangt ein wenig Restsportlichkeit, damit das Einsteigen halbwegs elegant gelingt. Drinnen dämmert, dass Ergonomie nicht unbedingt im Lastenheft von Sir Lyons gestanden haben mag. Noch mehr als in anderen Autos dieser Epoche sitzt man vor und nicht im Cockpit, das Lenkrad steht verdammt nahe an der Tür und am Fahrer sowieso. Dazu wirken die Sitze irgendwie zu klein geraten, der Schaltknüppel ist gerade noch erreichbar.

Den Ruf als eher behäbiges Wochenend-Spielzeug für erfolgreiche Zahnärzte verdiente sich der E-Type in den späteren Serien. Die erste Baureihe hingegen ist ein knackiger Vollblut-Sportler auf Augenhöhe mit der Konkurrenz seiner Zeit. Wer den Roadster bevorzugt, tauscht Frischluft gegen originellen Individualismus.
Das Starten ist eine beinahe eucharistieartige Zeremonie: Strom an, Zündung an, Choke ziehen, Startknopf drücken. Der sechskehlige Geselle erwacht äußerst manierlich zum Leben – ein Dankgebet an Lucas, Patron der Kranken, in England vor allem der kränklichen Elektrik. Der Motor läuft völlig rund und sauber, nimmt solide Gas an. Kräftig zieht der Wagen aus dem Stand, die Schaltung verlangt Gefühl, die Gänge rasten spürbar, aber präzise ein – mit dem Erstarken des Motors von 3,8 auf 4,2 Liter ab Ende 1964 leistete sich Jaguar auch den Luxus eines vollsynchronisierten Getriebes. Die davor verwendete Moss-Variante hatte sich einen wenig schmeichelhaften Spitznamen erarbeitet: Crash-Box. Das Runterschalten gelingt mit Zwischengas dennoch sauberer – das kurze Antippen des Gaspedals ist ohnehin eine schöne sportliche Reminiszenz an die Vergangenheit.
Das Coupé gleitet geschmeidig über die englischen Landstraßen, deren Enge stur die Existenz von Gegenverkehr leugnet. Die Karosserie ist straff gefedert, der Fahrkomfort trotzdem hervorragend. In den Kurven hängt sich der Wagen, der zwar lang und gestreckt wirkt, tatsächlich aber kaum länger ist als ein moderner Golf und mit knapp zwanzig Zentimeter weniger Radstand auskommt, leidenschaftlich in die Kurven. Danach läuft er sofort wieder absolut spurtreu geradeaus und hechtet ohne Widerstand mutig in die nächste Biegung. Wer den Kraftüberschuss an der Hinterachse mutwillig einsetzt, hat allerdings zu tun, das 4,4 Meter lange Pendel wieder auszurichten. Insgesamt schwindet aber mit jedem Kilometer die Befürchtung, es hier mit einem schwer zu zähmenden Problembären zu tun zu haben – so wie der Respekt vor dem feinbalancierten Gesamtkunstwerk E-Type zunimmt.
- Pingelige US-Sicherheits-Vorschriften killten später die hübschen Glasdeckel …
- und am Ende auch sonst viel von der Eleganz des Ur-E-Type wie etwa die zierlichen, direkt auf der Karosserie sitzenden Stoßstangen sowie die filigranen Heckleuchten,
- Der Reihensechszylinder macht viel Freude, hatte aber zu seiner Zeit den Ruf nicht drehzahlfest zu sein – weswegen nur wenige Menschen die 240 km/h reuelos erfahren konnten.
- Gutes Rad ist teuer – auf kaum einem Auto werden edle Speichenräder eher erwartet als auf dem E-Type. Als problematisch galten seinerzeit aber die für dieses Leistungsspektrum etwas unterdimensionierten Gummis.
Die seltsame Sitzposition stört überhaupt nicht mehr, der richtige Winkel für die Arme beim Lenken ist ebenfalls gefunden, man passt sich einfach in das Konzept ein. Die nominellen 240 km/h Spitze haben wir natürlich nicht ausprobiert – aber großzügig ausgelegtes Landstraßentempo stemmt der sexy Brite mit unglaublicher Lässigkeit. Der Motor teilt akustisch mit, dass er Drehzahlen über 4000 nicht allzu sehr schätzt, er braucht sie allerdings auch nicht. Dass die nominell 269 Pferde erst bei 5000 Umdrehungen voll antraben – geschenkt. Der Langhuber ist auch darunter extrem elastisch und hat gefühlt immer Kraftreserven. Rund sieben Sekunden auf den ersten Hunderter waren Mitte der 60er-Jahre schon eine Ansage. Dazu kommt die bemerkenswerte Laufruhe des Aggregats, das wirklich nur good vibrations austeilt. Genau das ist es auch, was den Gesamtreiz ausmacht: stets Leistung ohne Zwang abrufen zu können, dazu die seismo-
graphische Reaktion des ganzen Geräts auf jedes Kommando von Volant oder Gaspedal – und mit etwas beherztem Wadleinsatz auch von der Bremse.
Für die Anreicherung des Kults um den E-Type ist das mehr als ausreichend – obwohl nicht geklärt ist, wie viele Kunden das seinerzeit so positiv erleben konnten. Die Verarbeitungsqualität hatte bei Jaguar damals wohl einigen Spielraum nach oben. Sir Lyons war ein beinharter Knauserer, kaufte so billig wie möglich zu und war auch in der Fertigung selbst ständig hinter Einsparungen her, um den Spottpreis von nur etwa einem Drittel eines vergleichbaren Ferrari halten zu können. Die daraus resultierende Fehleranfälligkeit war generös über das ganze Auto verteilt und zeigte sich sogar von außen recht anschaulich: Ein restauriertes Fahrzeug erkennt man daran, dass die Spaltmaße passen, die Türen schließen und die Scheiben dicht sind.
So gesehen ist unser bei Jaguar Land Rover Classic auferstandener Proband der eigentlich endgültige E-Type: viel besser, als es die Baureihe tatsächlich jemals war, endlich reuelos der eigentlichen Bestimmung dienend. Kritiker könnten meinen, die Perfektion nehme dem Auto die Seele. Tatsächlich hat es dank ihr eine, die rein und schön ist. Der Ablasshandel kommt allerdings teuer: Ab 330.000 Euro beginnt der Spaß für ein Linkslenker-Coupé der ersten Serie mit 3,8 Liter-Motor. Mehr als das Doppelte des aktuellen Zustand 1-Marktwerts – allerdings, dem Kult-Genuss wohl auch nicht abträglich, mit offizieller Neuwagen-Garantie von Jaguar.
Daten & Fakten
R6, 12V, 3 Vergaser SU HD8, 4235 ccm, 269 PS bei 5000/min, 384 Nm bei 2500/min, Viergang-Getriebe, Hinterradantrieb, vorne Einzelradaufhängung mit Torsionstäben, doppeltem Dreieckslenker, Teleskopdämpfer und Stabilisator, hinten Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern, Schraubenfedern und Teleskopdämpfer sowie Stabilisator, Scheibenbremsen v/h, Zahnstangen-Lenkung, L/B/H 4440/1650/1220 mm, Radstand 2440 mm, Spurweite v/h 1270/1270 mm, Wendekreis 11,3 m, Reifendimension 6.40–15, 2 Sitze, Leergewicht 1315 kg, Tankinhalt 64 l, 0–100 km/h 7,1 sek , Spitze 246 km/h, Verbrauch Reise (Werk) 13–15 l /100 km
Bauzeit: 1964–1968 (Serie 1 und 1,5)
Lebenslauf:
1961: am 15. März Präsentation des E-Type auf dem Automobilsalon in Genf mit 3,8 Liter Reihensechszylinder, 265 PS und 325 Nm; Verkauf sowohl als zweisitziges Coupé namens FHC (Fixed Head Coupé) und als Roadster namens OTS (Open Two Seater); 1964: ab Oktober Anhebung des Hubraums auf 4,2 Liter, 265 PS und 384 Nm, Getriebe mit synchronisiertem erstem Gang, verbesserte Sitze; optional Speichenräder sowie Hardtop für OTS verfügbar; 1966: FHC 2+2 Sitzer mit um 23 Zentimeter verlängertem Radstand und optionaler Dreigang-Automatik ergänzt Angebot; 1967: bei von Jänner bis Juli gebauten Fahrzeugen Entfall der Scheinwerferdeckel und Anhebung der Scheinwerfer-Höhe; ab August inoffiziell Serie 1,5 aufgrund strengerer US-Sicherheitsbestimmungen: offene Scheinwerfer, geänderte Schalter am Armaturenbrett, 2 Zenith-Vergaser, keine Felgen mit Zentralverschluss mehr, Leistung sinkt auf 249 PS und 357 Nm; 1968: Serie 2, technisch ident mit Serie 1,5, aber mit geänderten Stoßstangen, größerem Lufteinlass vorne, Lenkradsperre und Zündschloss in einem, optional Servolenkung und Klimaanlage erhältlich; 1971: Serie 3 mit 5,3 Liter-V12 und 254 PS auf langem Radstand, FHC nur noch als 2+2, OTS als Zweisitzer; geänderte Stoßstangen, außen aufgesetzter Kühlergrill, Heckleuchten des Alfa Romeo GT Coupé („Bertone“); Automatik und Stahlgürtelreifen als Option; Einstellung der Sechszylinder-Modelle wegen geringer Nachfrage; 1975: Einstellung der Produktion, im September Ablöse durch den XJ-S
Stückzahlen: 7772 (4,2 Liter Serie 1 und 1,5 – insgesamt 65.899 E-Type)
Neupreis (1964): € 12.260,–
Marktwert heute (guter Zustand laut Classic Analytics): ca. € 85.000,– (Serie 1) bzw. 61.400,– (Serie 1,5)
Alternativen: Alfa Romeo 2600 Sprint Coupé, Aston Martin DB5 und DB6, BMW 2800 CS, Ferrari 330 & 365 GTC, Iso Rivolta GT, Lamborghini 400 GT & Islero, Lancia Flaminia Coupé, Maserati Sebring & Mistral