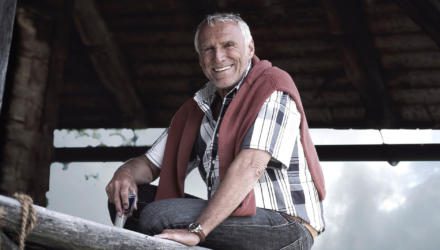Motorsport ist gefährlich. Mit diesem Leitmotiv meint Fiat in den 60er-Jahren allerdings weniger die Fahrer, sondern vielmehr sich selbst. Fiat-Boss Vittorio Valetta kennt natürlich den Hang seiner Landsleute, prinzipiell mit allem, was Räder hat, beherzt um die Wette zu fahren. Für die Baureihe 124 gibt er daher eine, wie er meint, besonders gefinkelte Direktive heraus: Die Kubaturen müssen stets zwischen den damaligen Hubraum-Klassen für den Motorsport mit 1,1, 1,3 und 1,6 Litern liegen, damit sie immer für die eine Kategorie zu groß, für die nächste aber zu schwach sind. Valetta meint es gut – aber sein Motoren-Entwickler Lampredi macht es besser. Der von Ferrari zu Fiat gewechselte Konstrukteur jubelt seiner Chefetage ein kreuzbraves Motörchen unter, das jedoch alle Anlagen für höhere Leistungs-Weihen in sich trägt. Etwa zwei oben liegende Nockenwellen, eine fünffach gelagerte Kurbelwelle, dazu eine unerschütterliche Ölversorgung und einen variabel anzubringenden Verteilerantrieb. Nicht zuletzt eine außerordentliche Tauglichkeit für Änderungen von Hub und Bohrung, also jede nur erdenkliche Anhebung des Hubraums.

Generationentreffen: zwei Brüder im Trainings-Anzug, die 45 Jahre trennen und außer dem Namen ein herrlich ehrliches Fahrgefühl eint. Wo Abarth 124 draufsteht, ist damals wie heute jede Menge Sportsgeist drin.
Lampredi wird Chef der 1971 von Fiat übernommenen Marke Abarth, womit der Bock endgültig auch noch den Gärtner geben darf. Sein inzwischen ohnhin schon hubraumvergrößert in anderen Fiat-Modellen verwendetes Aggregat erfährt damit sogleich die nächste Evolutionsstufe. Auch Ford und Opel setzen schon Wettbewerbs-Versionen solider Brot-und-Butter-Modelle im Motorsport ein – das tut dem Marketing gut und den Kunden erst recht: Optisches Tuning mit Rallye-Streifen wird erstmals beliebt. Fiat kann sich also erfolgreich einreden, dass der heiße Abarth 124 Rally für fast 50 Prozent Mehrpreis gegenüber einem zivilen 124 Cabrio nicht einfach nur zutiefst italienische Oktan-Instinke befriedigt, sondern eine verkaufsfördernde Maßnahme ist. Dass 95 Prozent der Cabrio-Produktion in die USA exportiert werden, wo europäischer Rallyesport keinerlei Wahrnehmung erfährt, fällt dabei unter den Tisch. Aber vielleicht haben sich ein paar Leute in der Alten Welt ja tatsächlich eine solide 124 Limousine gekauft, weil deren Ableger ein gar so fetziges Renngerät war.
- Sport-Ambiente einst und jetzt: Das Cockpit ist da wie dort kompakt, nur war Ergonomie in den 70er eine eher unterschätzte Disziplin.
- Was ihm an ihr fehlt, macht der Ur-Abarth mit der Direktheit des Erlebens und dem unschlagbaren Spursinn einer rein mechanischen Lenkung wett.
Motorisch ist die Abarth-Evolution tatsächlich eher simpler Art: Der 1756 Kubikzentimeter-Motor wird kurzerhand von der Limousine 132 entliehen, mit zwei Weber 44 IDF-Fallstromvergasern plus modifiziertem Saugrohr und Auspuffkrümmer versehen. Auch sonst greift Abarth im großen Fiat-Baukasten ungeniert zu – und am Ende hat der Abarth 124 Rally alles, was ein erstklassiges Wettbewerbs-Fahrzeug braucht: einen potenten Motor, sportliche Achsübersetzung, Einzelradaufhängung rundum, Sperrdifferenzial, breite Spur, solide Bremsen.
Im November 1972, fast zeitgleich mit dem Turiner Automobilsalon, lädt Fiat dann nach Rapallo zur Presse-Präsentation des ersten Abarth unter Fiat-Regie. Die ligurische Küste ist ein passendes Geläuf für das Auto, hier warten massenweise Bergstraßen mit endlosen, harmonischen Kurvenfolgen auf und ab. Das Urteil der damaligen Kollegen fällt durchwegs positiv aus – der Rest ist (Motorsport-) Geschichte. Die Abarths toben in zahlreichen Varianten viele Jahre über die Schotterpisten und Waldwege Europas. Das interne Konzern-Duell zwischen Fiat und Lancia ist legendär. Mit einer Produktion von nur 1013 Stück ist der von Abarth angespitzte 124 eine besondere Rarität geblieben – die Opferzahlen an kaltverformten Rallye-Geräten haben dem Bestand zudem schon zu Lebzeiten zugesetzt.
- Der Urahn bekam statt der Holzpanele im zivilen 124 kurzerhand ein Alu-Armaturenbrett verpasst, die Instrumente selbst veränderten sich nicht.
- Sein Nachfolger gibt sich mit rot hinterlegtem Drehzahlmesser und Tachoskala bis 270 sportlich.
Dass es den neuen Abarth 124 überhaubt gibt, ist eine kaum weniger wundersame Geschichte. Zunächst einmal musste dafür die schon zum Kapperl- und Regenschirm-Merchandiser heruntergekomme Marke Abarth reanimiert werden. Ohne den unerwarteten Erfolg des Fiat 500 wäre es wohl gar nichts geworden mit einem echten Marken-Revival – der Cinquecento war einfach wie geschaffen für einen hitzigen Ableger. Inzwischen hat Fiat sogar den alten Firmensitz wiederbelebt – inklusive einer liebevollen Restaurierung der Räumlichkeiten des Marken-Gründers. Auf dem Tisch steht jeden Tag eine Schale frischer Äpfel, so wie Karl Abarth es seinerzeit angeordnet hatte.
2011 führt der bisweilen sehr pragmatische Ansatz von Fiat-Chef Sergie Marchionne zu einer Kooperation von Alfa Romeo und Mazda. Die Japaner haben zu diesem Zeitpunkt etwas, was den Italienern bitter fehlt: eine Heckantriebs-Plattform und über Jahrzehnte gepflegte Kompetenz im Bau von kompakten Roadstern erster Güte. Der nächste Alfa Romeo Spider soll also in Kooperation mit Mazda entstehen und eng mit dem MX-5 verwandt sein. Die Vorfreude der Massen ist überschaubar, und auch bei Fiat/Alfa selbst gerät der Haussegen deswegen ein wenig in Schieflage. Es folgt einer der berüchtigten Marchionne-Schwenker, mit denen der Chef in seiner Meinung grußlos abbiegt und akute Neuigkeiten verkündet: Eine Mazda-Plattform passe nicht zum Premium-Anspruch von Alfa Romeo, erklärt er 2013 – aber man dürfe sich auf ein Fiat-Cabio aus dieser Kooperation freuen. Auf der Los Angeles Motor Show im November 2015 feiert der neue Fiat 124 dann schließlich Premiere. Ungeniert mit den Attributen der Ahnen spielend, ohne deswegen nur retro zu sein. Dazu die Verheißung einer kräftiger gewürzten Variante – und dass sie unter dem Skorpion fahren wird.
- Warum damals das Cabrio für die sportlichen Ambitionen auserkoren und dafür mit einem Hardtop versehen wurde, ist bis heute ein Rätsel. Es hätte auch ein technisch baugleiches Coupé gegeben.
- Nach oben offener Sport-Spaß: Der Abarth 124 von heute wird als Cabrio ausgeliefert, ein Hardtop findet sich nur im Zubehör-Katalog.
Der 1,4 Liter-Turbo-Benziner aus dem Fiat-Regal in der 170 PS-Ausbaustufe befeuert den Abarth 124 recht gut – mit den nur 1060 Kilo Leergewicht hat der Motor leichtes Spiel. Straffere Zügel haben auch Fahrwerk und Lenkung bekommen, das manuelle Getriebe stammt aus der Generation drei des MX-5, traditionell mit knappen präzisen Schaltwegen glänzend. Die optionale Automatik sei hier unlöblich erwähnt – wer sie wählt, verleidet sich ein gehöriges Maß an Fahrfreude.
Auch der Ahnherr von 1973 ist in Sachen knackiger Schaltung vorbildlich. Die Übersetzungen von Gang eins bis drei sind recht kurz, ab der Vierten geht es mit linearem Schub dahin. Der Motor klingt rau, aber nicht räudig, ab 2500 Umdrehungen beginnt er sich merkbar wohler zu fühlen, legt aber nach oben hin unbeeindruckt zu. 7000 Touren tun ihm nicht weh, im Gegenteil – genau dort sitzt fühlbar der Skorpion-Stachel. Die Kupplung greift hart und gierig, die Lenkung ist bei höherem Tempo um die Mittellage herum ein wenig nervös. Spurtreue und Kompaktheit des ganzen Dings an sich sind aber bemerkenswert. Die Bewunderung für und die Zuversicht in die Leistung des damaligen Abarth-Teams steigen von Kurve zu Kurve, in die sich das Hardtop-Cabrio willig reinhängt – inklusive gut befriedigtem Spieltrieb mit Leistung und Fliehkräften an der Hinterachse. Das Ganze eingehüllt in eine herrlich detailverliebte Sport-Atmosphäre mit Alu-Armaturenbrett und minimalistischem Innenspiegel, dafür aber ohne Handschuhfachdeckel, Sonnenblenden, Mittelkonsole und Rückbank – der Gewichtsreduzierung auch hinter dem Komma geschuldet, die aber größtenteils von Überrollbügel und Hardtop wieder aufgewogen werden.
- Kraftpakete aus zwei Epochen: Anfang der 70er-Jahre galten zwei oben liegende Nockenwellen schon als technische Feinkost.
- Der TwinAir-Turbo im aktuellen Abarth steuert eine Ventilbank schon rein elektronisch und ohne Nockenwelle.
In Sachen Klang steht ihm sein Enkel um nichts nach: Der Abarth 124 von heute sprotzt und röchelt in allen Tonlagen, dass es eine Freude ist. Auch hier liegt die Lust in der Reduzierung. Erst den Sport-Modus rein, dann das ESP vollständig abschalten – man braucht dafür keine zehn Sekunden auf den Knopf drücken, wie es die deutsche Vollkasko-Mentalität so gern einrichtet. Einmal antippen – und schon lässt sich der Abarth zielsicher mit dem Gaspedal durch die Kurven lenken. Dank fast 100 Newtonmetern mehr Drehmoment bei deutlich niedrigerer Drehzahl sogar leichtfüßiger als sein Ahne, aber mit demselben Gefühl, Herr über die Maschine zu sein und nicht umgekehrt. Dass es 2017 überhaupt noch ein Auto gibt, das in so vielen Faktoren ganz nahe bei einem 45 Jahre alten Urmeter an Fahrspaß liegt, ist an sich schon ein halbes Wunder. Auch hier geht einerseits ein neidloser Dank nach Fernost für die schönste Kulturleistung Japans der Neuzeit: die Rekultivierung des Roadsters. Und ein weiterer nach Italien für die sorgsame Denkmalpflege und das liebevolle Übertragen von archaisch-schönen Eindrücken aus der Vergangenheit ins Jetzt.
Vittorio Valetta, der verhinderte Verhinderer von Motorsport-Ambitionen, hat den Einsatz des Ur-Abarth 124 nicht mehr erlebt – er stirbt schon 1967, lange bevor sich jemand an seinen vermeintlich tuning-sicheren Motoren und braven Autos zu vergreifen beginnt. Der Abarth 124 von heute schickt sich an, in die Fußstapfen seines Ahnen zu treten: Eine 300 PS starke Rallye-Variante ist längst FIA-homologiert und wird von Privatteams eingesetzt. Geschichte wiederholt sich immer, heißt es. So ein Glück!
- Das hochgezogene Heck lässt den modernen Abarth wuchtiger wirken – der Eindruck täuscht aber: Bis auf wenige Zentimeter sind die Abmessungen fast gleich.
- Die Fasten-Kur der 70er-Jahre umfasst unter anderem Fiberglas-Deckel vorne und hinten, den Entfall der Stoßstangen, dazu Aluminiumhäute an Türen und Schweller-Verkleidungen. Die Neuauflage ist von Natur aus ein Leichtgewicht.